Texte
![]() Carl
Aigner_PICTURE ELEMENTS, 2013
Carl
Aigner_PICTURE ELEMENTS, 2013
![]() Carl
Aigner_BILDSTÖRUNGEN, 2013
Carl
Aigner_BILDSTÖRUNGEN, 2013
![]() Hartwig
Knack_BILDPUNKTE - Kodierung der Wirklichkeit, 2011
Hartwig
Knack_BILDPUNKTE - Kodierung der Wirklichkeit, 2011
 juergenwagner MALEREI 2.0
(Malerei ab 2010)
juergenwagner MALEREI 2.0
(Malerei ab 2010)
Ich verstehe mich als Maler des Informationszeitalters - im Speziellen ab dem Zeitpunkt der Digitalen Revolution.
Stichworte sind "pixel", "QR_Codes" und Phänomene im Zusammenhang mit Digitalität (zB: "Interferenzen" beim TV-Empfang = "Glitch").
Diese Begriffe lasse ich in meine Malerei einfließen bzw. setze mich mit diesen auseinander. So heißen meine aktuellen Werkreihen "pixit!","QR_pixel" und "TV-Interferenzen" (Glitch-paintings).
 pixit!
Schon in der Antike begegnen uns quadratische, einfärbige Farbkästchen, die in Mosaiken zu Bildern zusammengesetzt
wurden. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der quadratischen Pixel ist das legendäre Pixelportrait Abraham Lincolns vom Kybernetiker Leon D. Harmon aus den
50er Jahren des 20. Jahrhunderts (siehe Hartwig Knack im Katalogtext "jürgen wagner .BILDPUNKTE", 2011). Seit der digitalen Revolution des auslaufenden 20.
Jahrhunderts begegnen uns diese Quadrate und Rechtecke nun tagtäglich in der Fotografie, am PC und vor allem auch im TV.
pixit!
Schon in der Antike begegnen uns quadratische, einfärbige Farbkästchen, die in Mosaiken zu Bildern zusammengesetzt
wurden. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der quadratischen Pixel ist das legendäre Pixelportrait Abraham Lincolns vom Kybernetiker Leon D. Harmon aus den
50er Jahren des 20. Jahrhunderts (siehe Hartwig Knack im Katalogtext "jürgen wagner .BILDPUNKTE", 2011). Seit der digitalen Revolution des auslaufenden 20.
Jahrhunderts begegnen uns diese Quadrate und Rechtecke nun tagtäglich in der Fotografie, am PC und vor allem auch im TV.
Diesem aktuellen Trend folgend, habe ich meine Malerei diesem Thema gewidmet. Der Verpixelungsgrad meiner Werke ist meist so gewählt, daß Sie vor dem Gemälde stehend, nichts als einfärbige Quadrate und Rechtecke wahrnehmen, also ein geometrisch-abstraktes Bild vor sich haben. Entfernen Sie sich, setzten sich diese Pixel zu einem mehr oder weniger konkreten Bild zusammen - Sie sind dabei auch gefordert, Ihre eigne Phantasie in gewissem Ausmaß beim Betrachten einzusetzen. Und umgekehrt - wenn Sie aus der Entfernung eine konkrete Darstellung wahrnehmen und sich die Einzelheiten aus der Nähe ansehen möchten - stehen Sie plötzlich vor den quadratisch-rechteckigen Atomen des konkret Dargestellten.
Die Neuerungen auf dem Handymarkt, wie Kamerafunktionen und Smartphones haben mir auch Impulse für meine Malerei geliefert: durch die Kameras von Handys gesehen, konkretisieren sich meine Bilder auch aus der Nähe - eine mir wichtige Komponente im Umgang mit meinen Arbeiten. Die Kunststoff-Oberfläche von Touch-Screens der Smartphones haben mich zum Überziehen einiger Werke mit einer dicken, ebenen Firnisschicht animiert.
![]() QR_pixel.
In diesen Werken kommuniziere ich zusätzlich mit den Betrachtern meiner Bilder über die QR-Codes; diese benötigen, um die ganze Bildinformation zu
erhalten - also nicht nur das primär optische Erscheinungsbild meines Werkes - ein Smartphone, das den Code mittels QR_Code-Reader
"dechiffrieren" kann: somit können auf den Bildschirmen der Smartphones Texte, Fotos, Filme usw. erscheinen - ich erweitere die
gewohnten optischen Bildinformationen meiner Werke um diese Möglichkeiten.
QR_pixel.
In diesen Werken kommuniziere ich zusätzlich mit den Betrachtern meiner Bilder über die QR-Codes; diese benötigen, um die ganze Bildinformation zu
erhalten - also nicht nur das primär optische Erscheinungsbild meines Werkes - ein Smartphone, das den Code mittels QR_Code-Reader
"dechiffrieren" kann: somit können auf den Bildschirmen der Smartphones Texte, Fotos, Filme usw. erscheinen - ich erweitere die
gewohnten optischen Bildinformationen meiner Werke um diese Möglichkeiten.
 TV-Interferenzen
(Glitch-paintings).
Im digitalen Fernsehzeitalter (zB. via Satelliten) begleiten uns
Störungen beim Empfang von Filmen und Sendungen
= "Glitch".
TV-Interferenzen
(Glitch-paintings).
Im digitalen Fernsehzeitalter (zB. via Satelliten) begleiten uns
Störungen beim Empfang von Filmen und Sendungen
= "Glitch".
Bei Blitzeinschlägen, starkem Regen usw. zerlegen sich unsere Fernsehbilder mehr oder weniger stark, sofern sie nicht gänzlich verschwinden. Diese äußerst kurzlebigen Meisterwerke habe ich eingefangen und zu meinen "Interferenzen" verdichtet.
Diese spannenden Momentaufnahmen reichen von konkreten Bildern bis zu vollkommen abstrakten Darstellungen. Beim "Zappen", also beim Hin- und Herspringen zwischen den einzelnen Fernsehkanälen, verschachteln sich ab und zu die Filme ineinander - und formen damit gänzlich neue Seheindrücke.
Zu den einzelnen TV-Interferenzen-Gruppen 1, 2 und 3:
Interferenzen I (Glitch-paintings ab 2010): die Interferenzen finden auf einem Röhrenfarbfernseher statt, wobei ich die Cinemascope-Streifen mitgemalt habe.
Interferenzen II (Glitch-paintings ab 2014): die Interferenzen finden auf einem Röhrenfarbfernseher statt, wobei ich diesmal die Cinemascope-Streifen weggelassen habe (und damit auch eine größere Breite der Bilder erreiche).
Interferenzen III (Glitch-paintings ab 2022): die Interferenzen finden auf einem Digital-Farbfernseher statt. Dadurch bilden sich andere Interferenzen, da der Bildschirmaufbau ein anderer ist.
Meine Glitch-paintings sind tatsächlich auf meinen TV-screens aufgetretene "Glitches", die ich bei Auftreten dieser Phänomene sofort fotografiert und dann malerisch umgesetzt habe.
Definition Glitch (Media) lt. Wikipedia (Auszug): Als Glitch wird in der Fernseh- und Videotechnik eine kurzzeitige Falschausgabe von Bild- oder Toninhalten bezeichnet, ähnlich den Glitches in der Elektronik. ..... Ebenfalls entstehen Glitches beim Interpolieren von einzelnen Datenbestandteilen des Signals, die bei einem Kopier- oder Übertragungsvorgang verfälscht oder ausgelassen wurden. Im Bild wirkt sich das durch vermehrte Artefaktbildung oder gar andersfarbige Klötzchenbildung aus. Beim Ton kann es zu störenden Verzerrungen der Frequenz oder zu Nebengeräuschen kommen.
Siehe auch "Glitch - Die Kunst der Störung", Publikation anläßlich der Ausstellung in der Pinakothek der Moderne, München (1. Dezember 2023 bis 17. März 2024), die Seiten 154 und 157.
jürgen wagner, 2014, 2022 und 2024
 juergenwagner Neue Malerei ab 2019
juergenwagner Neue Malerei ab 2019
 materialic. OP-ART. Materialität. Reflektor. Farbe. Oberfläche.
materialic. OP-ART. Materialität. Reflektor. Farbe. Oberfläche.
Auf einer Leinwand sind zwei Alu-Folien aufkaschiert (mit einem kleinen Abstand zueinander) und dienen als Reflektor für auftreffendes Licht (Tageslicht, wie künstliches Licht).
Darüber ist eine etwas transparente Akryl-Farbe aufgetragen, in verschiedener Schichtdicke, damit man partiell - je nach Rückstrahlung des auftreffenden Lichtes - verschiedene
Farbeffekte hat (fast nur Alu-Folie sichtbar bis hin zu voll deckender Akrylfarbe (dort, wo das Licht durch die dicke, intensive Farbschicht nicht mehr hindurch kann)).
 coated.
OP-ART.
coated.
OP-ART.
Ein komplexer Aufbau: auf einer Leinwand ist Alu-Folie aufkaschiert und dient als Reflektor für auftreffendes Licht (Tageslicht, wie künstliches Licht).
Darüber ist entweder (Fall 1 = großflächige Aufkaschierung der Alu-Folie) eine Akryl-Farblasur aufgetragen, in verschiedener Schichtdicke, damit man partiell - je nach Rückstrahlung
des auftreffenden Lichtes - verschiedene Farbeffekte hat (fast nur Alu-Folie sichtbar bis hin zu voller Farbkraft (dort, wo das Licht durch die dicke, intensive Farbschicht nicht
hindurch kann)). Im Fall 2 (= kleinflächigere Aufkaschierung von Alu-Folie) ist neben der Alu-Folie(-n) weitere Akrylfarbe aufgetragen (in verschiedenen Farbvarianten).
Darüber ist dann (in beiden Fallvarianten) eine transparente, meist farbige Luftpolsterfolie gespannt, die wie eine transparente Farblasur auf der „Untermalung“ (= Alu-Folie +
Akryl-Farblasur/Akrylfarbe), dieser Untermalung einen neuen Farbwert gibt (optische Addition der beiden Farbwerte).
Ein weiterer optischer Effekt ist, daß bei schräger Betrachtung
des Bildes, die Farbe der Luftpolsterfolie stärker sichtbar wird, bei direktem Betrachten von vorne aber die optische Farbaddition voll zur Wirkung kommt.
 Wrapped Bubbles.
LUPO-Materialbilder. Dreidimensionale Wandobjekte.
Wrapped Bubbles.
LUPO-Materialbilder. Dreidimensionale Wandobjekte.
Statt einer Leinwand spanne ich hier eine Luftpolsterfolie auf einen Keilrahmen auf.
Oder ich kaschiere die Luftpolsterfolie vorab auf eine Leinwand und spanne diese
dann auf einen Keilrahmen.
Mein Farbauftrag erfolgt hier auf den Zierleisten (=Künstlerrahmung).
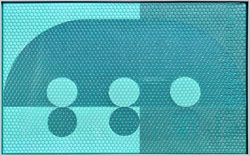 OP-A.green OP-ART.
OP-A.green OP-ART.
Ein komplexer Aufbau: auf einer Leinwand ist, partiell in verschiedenen Formgebungen, eine Alu-Folie aufkaschiert und dient als Reflektor für auftreffendes
Licht (Tageslicht, wie künstliches Licht). Auf den freien Flächen ist dann Akrylfarbe aufgetragen, derzeit meist Weiß und Aluminiumfarben. Darüber ist dann
eine transparente, grüne Luftpolsterfolie gespannt, die wie eine transparente Farblasur auf der „Untermalung“ (= Alu-Folie + Akrylfarbe), dieser Untermalung
einen neuen Farbwert gibt (optische Addition der beiden Farbwerte).
Ein weiterer optischer Effekt ist, daß bei schräger Betrachtung des Bildes, diese grüne
Luftpolsterfolie stärker sichtbar wird, bei direktem Betrachten von vorne aber die optische Farbaddition zur Wirkung kommt.
jürgen wagner, 2019
 juergenwagner Neue Arbeiten ab 2021
juergenwagner Neue Arbeiten ab 2021
 OP-A.bubbles OP-ART.
Dreidimensionale Wandobjekte.
OP-A.bubbles OP-ART.
Dreidimensionale Wandobjekte.
Zwei Luftpolsterfolien übereinander auf einen Keilrahmen
gespannt. Oder zwei Luftpolsterfolien über eine Leinwand mit - in verschiedenen Formgebungen aufkaschierter Alu-Folie (= Reflektor) - gespannt.
Bei Betrachten des Bildes ergeben sich verschiedene "Optische Effekte" durch das Zusammenspiel der beiden übereinander gelagerten
Luftpolsterfolien.
Ein weiterer optischer Effekt ist, daß bei schräger Betrachtung des Bildes, die oberste Luftpolsterfolie
farblich stärker sichtbar wird, bei direktem Betrachten von vorne aber die optische Addition bzw. Farbaddition (der Strukturen und der Eigenfarben
der jeweiligen Luftpolsterfolien) zur Wirkung kommt.
jürgen wagner, 2021
![]() Carl Aigner
Carl Aigner
 PICTURE ELEMENTS
PICTURE ELEMENTS
Malerei und Digitalität im rezenten
Werk von Jürgen Wagner
Wir blicken durch die Materie… Franz Marc
„Es ist an der Zeit, auch die Medienbilder nicht länger als Erscheinung aus dem Off zu betrachten, sondern auch die Materialität der neuen Medien zu berücksichtigen“, schrieb Monika Wagner in ihrer eindrucksvollen Publikation „Das Material der Kunst“ 2001. Was die Autorin hier nachdrücklich anspricht, ist die Herausforderung neuer Medientechnologien generell für die Gegenwartskunst, also die Frage nach Bezugnahmen, Feedbacks und Transformationen bereits vorhandener Bildmedien qua neuer technologischer Bildmöglichkeiten.
Spätestens mit der Erfindung des ersten apparativen Bildes, der Photographie, ist diese Herausforderung ein permanenter Prozess seit der Moderne. So sehr die Malerei mit der Erfindung des Licht-Bildes auch für tot erklärt wurde, so sehr revitalisierte sie sich in vielfältiger Weise die Malerei als Reaktion auf die Photographie. Neue Themen, neue ästhetische Perspektiven, neue Verfahrensweisen waren die Folge, die letztendlich zu einer neuen Definitionen der Malerei selbst führten. Wurden Photographie und Malerei lange als Kontrahenten betrachtet (was bild- und sozialgeschichtlich in mancher Hinsicht auch der Fall war), so entwickelte sich – oft verborgen – ein höchst produktives Verhältnis. Mehr noch: Die Photographie begann sukzessive, das Dispositiv „Bild“ generell zu formen und eine Feedbackwirkung zu entfalten, umso mehr, als die Malerei in immer größerem Ausmaß, zunächst nicht offenkundig, aber im Laufe der Zeit immer nachhaltiger, quasi protophotographische Dimensionen gewann (Ausschnitt, Realitätsverständnis, Details, Bildwürdigkeiten, ästhetische Selbstverständnisse). Die kurze Phase der photographischen Imitation der Malerei im späten 19. Jahrhundert führt schnell in eine bildnerische Sackgasse, impliziert das neue Bildmedium doch Aspekte wie Zeit, Bewegung oder Licht als immaterielle Bildproduktionsfaktoren, die ein absolutes Novum und Herausforderung für die Malerei darstellten. Wie sehr die Malerei jedoch auch die Photographie vereinnahmt, zeigt der Photorealismus der 1960er Jahre mit seinen appropriativen photographischen Tendenzen.
Erstaunlich, wie viele Parallelen sich diesbezüglich zwischen den neuen digitalen Bildformen und der Malerei seit den 1990er Jahren finden. Die Herausforderung digitaler Bildtechnologie transformierte die Malerei in zwei gegensätzliche Haltungen: Einerseits in das Entstehen einer neuen, energischen Geste der Malerei, andererseits in die bildnerische Analyse und Ästhetisierung spezifischer Medienparameter des Digitalen. Sie führten auch zu zwei grundsätzlichen Intentionen des Künstlerischen: das Techno-Imaginäre wurde Fokus des digitalen Bildes, während die sogenannte „Wirklichkeit“ neuerlich den Diskurs der Malerei zu bestimmen begann (Stichwort „Neue Gegenständlichkeit, „Neue Figuration“).
Bei diesbezüglichen Werken der Malerei findet sich die digitale Immanenz der „Pixel“ (= Picture Element) als Reflexionsfokus wider. Als kleine „Bildpunkte“, also Einheiten des elektronischen Bildes, sind diese „Bildzellen“ die Sensoren und Signale für den „Raster“ der Bildgewinnung generell. Sie stellen, biologisch gesprochen, das Basis-Gen elektronischer Bilder dar. Gleichzeitig sind sie Träger der Bildauflösungskapazitäten, die bestimmend für die Wahrnehmbarkeit des Gegenständlichen, Figurativen sind. Die Pixels generieren also eine neue Form der Bildrasterung, wie wir sie ansatzweise bei den frühen, zentralperspektivisch konzipierten Bildwerken und dann vor allem bei den Vervielfältigungsdruckmöglichkeiten seit dem 19. Jahrhundert wie etwa beim Offsetdrucken oder den technisch einfacher realisierbaren Siebdrucken finden.
Seit einigen Jahren beschäftigt sich Jürgen Wagner intensiv mit den Möglichkeiten einer malerischen Auslotung digitaler Rasterbilder, also den Pixeln als bildnerische Grundform. Ausgangspunkt sind meist Photographien von verschiedensten Sujets, die gescannt, also digitalisiert, in eine Pixelstruktur verwandelt werden. Auf Leinwänden wird eine Struktur aus vielen kleinen Quadraten skizziert, die gewissermaßen die digitale Pixelstruktur imitieren. Auf diese wird dann in verschiedenen Tiefenschärfen der digitalen Pixelstruktur das gescannte Bild mit Ölfarbe übertragen. Das daraus resultierende Mosaikfarbmuster ergibt, je nach der Tiefenstruktur und der daraus resultierenden Pixelgröße, eine einmal mehr und einmal weniger markante Figuration der betreffenden Sujets. Je weniger die Pixels im Prozess der Übersetzung vom Digitalen in die Malerei „gezoomt“ werden, umso „abstrakter“ wirken die mosaikähnlichen Bildstrukturen.
Im Ausloten der ästhetischen Möglichkeiten spielt also die Strategie der Übersetzung der digitalen Pixelstruktur in Malerei eine dezisive Rolle. Sie bewirkt nicht nur das Spannungsfeld von Gegenständlich und abstrakt, sondern auch von Wahrnehmbarkeit und Nichtwahrnehmbarkeit des Sujets. Es geht dabei weniger um Effekte des Verfremdens, als vielmehr um essentielle Fragestellungen nach unserer Wahrnehmung von Welt im Angesicht digitaler Medien grundsätzlich. Was ist das für ein Sehen bei den digitalen Medien? Welche bildexternen Referenzen werden (noch) tangiert, fungiert das digitale Bild hinsichtlich seiner Weltbezogenheit präphotographisch? Die photographische Metaphorik der Tiefenschärfe erfährt hier eine neue semantische Aufladung: je tiefer in die Pixelstruktur eingedrungen wird, umso detaillierter, jedoch unschärfer wird das dargestellte Sujet.
Wir kennen diesen Effekt nicht nur ansatzweise aus der Malerei des Impressionismus (oder etwa der byzantinischen Mosaikkunst), sondern kunsthistorisch insbesondere beim Pointilismus der 1880er und 1890er Jahre. Basierend auf den neuesten Erkenntnissen der damaligen Farblehre sowie den Erkenntnissen über das Funktionieren unserer Augen (Sehstäbchen und Sehzäpfchen) wurden die Sujets in Punkte aufgelöst, die erst bei distanzierter Betrachtung ein figuratives Erkennen zulassen, während bei naher Betrachtung eine punktförmige Rastermalstruktur sichtbar wird.
Ein minutiöses Augenmerk legt Jürgen Wagner im Prozess der Übersetzung auf Malerei als Malerei. Die einzelnen Pixelquadrate (übrigens: Pixel sind nicht ausschließlich quadratisch!) werden gespachtelt, ansatzweise sind sie pastos, ja expressiv, vor allem in den früheren Werken; immer wieder reißen sie aus den Rasterungen aus, werden ansatzweise organisch und sind nicht mehr streng geometrisch. Aus dieser „Kollision“ von technologischer Struktur und „organischer“ Handarbeit resultiert das Reizvolle und irritierende in der Bildbetrachtung. Der Blick ist hin- und hergerissen zwischen diesen beiden bildtechnischen Möglichkeiten und „scannt“ so zwischen zwei Bildwelten hin und her. Wie sehr Wagner sich technokratischen Bildstrukturen als Maler wiederum entzieht, erkennt man auch daran, dass er in jüngster Zeit auch die Quadratstruktur der Pixels aufbricht, weitere Unterteilungen vornimmt und so auch subversiv gegen Bild-Technologisches vorgeht.
Weit weg vom Gedanken einer Farbfeldmalerei, wie wir sie seit den 1920er Jahren kennen, erlaubt die neue Smartphontechnologie eine Rückübersetzung dieser Malerei in das digitale Dispositiv: Verbleiben die Pixelstruktur und deren Farbfelder in sehr grober Auflösung (womit die figurative Lesbarkeit des Bildes mit bloßem Auge verschwindet), so kann es auf dem Bildschirm eines Smartphons wiederum durch bloße digitale Aufnahme in seine Figuration rückübersetzt werden. Dieser bildtechnische Vorgang spiegelt jedoch eine eindringliche Metaphorik des Sehens in einer total mediatisierten Welt wieder. Die Wahrnehmung wird zu einem Wahr-Nehmen lediglich elektronisch-digitaler Parameter. In dieser „Dekonstruktion“ bildtechnologischer Universen gerät das Sehen zu einem Spielball des Virtuellen. Kraft der Malerei gelingt eine Wiederversinnlichung und -konkretisierung des Blicks angesichts des Verschwindens und Auflösens der Welt in digitalen Welten: haptisch, damit voluminös, ja selbst im Falle der Ölfarbe sogar riechbar.
Wenn eine Perspektive der Kunst die Erweiterung der Welt, ja des Weltbildes bedeutet, so ist der Dialog zwischen Malerei und digitalen Bildern eine Erweiterung vice versa beider Bildmöglichkeiten. Das Ausloten, Herantasten an die Möglichkeiten dieser „Übersetzungen“ ist gewiss eine Triebkraft der Bild-Werke von Jürgen Wagner, der, nicht zuletzt auf Grund seiner Tätigkeit als Restaurator, eine besondere Sensibilität für das Material „Malerei“ in diesen Bilddiskurs einzubringen vermag – denn jedes Bild ist auch immer etwas anderes als es zu sein scheint!
© für den Text: Mag. Carl Aigner, Direktor des Landesmuseums NÖ
![]() Carl Aigner
Carl Aigner
 BILDSTÖRUNGEN
BILDSTÖRUNGEN
Digitale Bildfehler als zeitdiagnostische Strategie im Werk von Jürgen Wagner
In einer vor vielen Jahren erschienen Publikation spürte der englische Arzt und Autor Patrick Trevor-Roper dem Einfluss von Wahrnehmungsstörungen und –abweichungen, also Sehfehlern bei KünstlerInnen im Hinblick auf sich dadurch neu eröffnende ästhetische Möglichkeiten nach. Dabei machte er wichtige, an diese physikalischen Gegebenheiten gebundene künstlerische Tendenzen sichtbar, die zu innovativen und progressiven Bildfindungen zu führen vermögen. Diese dem Auge immanenten Gegebenheiten, die auf bestimmten physikalischen Veränderungen beruhen, sind „logische“ Folge der physikalischen „Matrix“ des Auges. Dem Autor gelingt es, das Sehen als höchst dynamischen Prozess sichtbar zu machen. Die Feedbackwirkung von physikalischen Veränderungen des Auges auf seine Wahrnehmungsvermögen umfassen dabei Phänomene wie Unschärfe oder Distorsion, aber auch Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit im Akt der Wahrnehmung, die zu unerwarteten Bildfindungen führen. Es geht dabei ebenso um das „Unbewusste“ unseres Sehens, das sich bildnerisch zu reflektieren vermag, wie auch um den Zufall als Bildprinzip, wie er spätestens seit der Erfindung der Photographie bildtechnisch zu einem bestimmenden künstlerischen Bildfaktor wurde.
„Interferenzen“ betitelt Jürgen Wagner eine 2010 entstandene Werkserie. Sie basiert auf digitalen Bildstörungen von TV-Screens, wie sie etwa durch mangelhaft installierte Satellitenantennen oder durch wetterbedingte Kapriolen hervorgerufen werden. Ähnlich den physikalisch bedingten „Sehstörungen“ des Auges werden diese digitalen Bildstörungen in ihrer Ästhetik und Form durch die Matrix des Digitalen selbst in ihrer Pixelstruktur evoziert. Wir kennen dieses Phänomen auch im analogen TV als so genanntes „Bildrauschen“ oder „Bildflimmern“. Sie stellen gewissermaßen „autokatalytisch“ techno-mediale Bildmuster ihrer technoimmanenten pikturalen Potentiale dar.
Mit „Interferenz“ wird in der Physik die Überlagerung von Wellen oder Schwingungen identischer Herkunft bezeichnet. Die Werkserie bezieht sich nicht nur thematisch darauf, sondern auch auf einen medienspezifisch medialen Transfers von digitalen „Bildern“, deren digitale photographische Realisierung sowie der abschließenden „Übertragung“ in einen Diskurs der Malerei. Die sich durch äußere Faktoren ergebenden digitalen Bildstörungen auf Fernsehbildschirmen werden also zum „Operateur“ mehrschichtiger Bildtransfers, die auf dem Prinzip kontrapunktischer Verfahrensweisen beruhen: Die flüchtige, digitale Bildstörung wird durch hunderte digitalphotographischer Aufnahmen „fixiert“ und anschließend selektiert. Wesentlich dabei ist, dass keinerlei digitale Bearbeitung der realisierten digitalen Photoaufnahmen stattfindet. Diese Selektion bildet die Basis für die Realisierung als gemaltes Bild, wodurch ein Dialog zwischen Apparativem und Handwerklichem zusätzlich entsteht.
„Ich bin Maler, schon von meinem Großvater, Josef Maria Svoboda (1918 - 2003), diesbezüglich tief geprägt“, äußert sich dezidiert Jürgen Wagner auf die Frage, warum eine bildnerische Übersetzung in die Malerei erfolgt. Wurde in den ersten Arbeiten eine Vorzeichnung mit freier Hand auf die Leinwand aufgetragen, erfolgt in den neueren Arbeiten dies durch Lichtprojektion der Vorlage, die mit der Hand auf der Leinwand nachgezeichnet wird. Durch die ausschließliche Verwendung eines Spachtels als Werkzeug des Ölfarbauftrags und dessen linienförmige Setzung auf die Leinwand bleibt eine pixelartige Struktur in der Malerei erhalten, die allerdings – durch die Bildstörung bedingt – einen bildpixelartigen aufgerissenen, oft ausgefransten Eindruck hinterlässt. Nur ansatzweise sind die vielfältigen Sujets aus verschiedenen TV-Sendungen visuell erkennbar (etwa Fußball WM in Südafrika oder Spielfilmbildbruchstücke). Rätselbildartig referieren die aus einzelnen Malfragmenten bausteinartig zusammengesetzten Leinwandbilder die photodigitalen Vorbilder von TV-Sendungen. Im Spannungsfeld von erkennbar und nichterkennbar „diskutieren“ sie grundsätzliche Seinsweisen digitaler Bildinformationen.
Die pixelartigen, scheinbar chaotischen Bildstrukturen, die durch den Akt der Malerei eine neue, eigene Sinnlichkeit und materielle Existenz gewinnen, imaginieren einen polyperspektivischen Bildraum, der auf der Verfahrensweise der Verspachtelung und den intensiven hell-dunkel Kontrasten beruht. Postkubistische Formationen von geometrischen Strukturen diffundieren und diffusionieren simultan in ihrer bildnerischen Ambivalenz jedweden möglichen visuellen Angelpunkt. Damit simuliert dieser Werkkomplex eine reale Gegebenheit im Universum des Digitalen, in einer verpixelten Welt, worauf der südamerikanischen, aus Prag stammende Medienphilosoph Vilém Flusser bereits vor Jahrzehnten in seinem Buch „Ins Universum der technischen Bilder“ aufmerksam gemacht hat.
Die durch diverse Empfangsstörungen und Interferenzen sich de-komponierenden immateriellen Medienbilder anarchisieren dabei beides: die Medienbilder per se und gleichzeitig als rezeptiven Effekt unsere Wahrnehmung eben dieser Medienbilder als antinaturalistisch und antirealistisch. Die scheinbare Glätte und Wirklichkeitseffizienz der pausenlos auf uns eindringenden virtuellen Bilderwelten wird unterlaufen und als Medienkonstrukt dekonstruiert. Die im ersten Moment dabei empfundene persönliche Sehstörung ist, anders etwa bei einem Astigmatismus des Auges, eine medienintrinsische Erfahrung und Irritation.
Es geht also um mehr als das Moment einer Verfremdung von Bildern und damit auch unserer Wahrnehmung, die sich im Dialog von Medienwelten und Malerei konfrontieren. Im Fokus der „Interferenzen“ steht die je eigene Seherfahrung und die Reflexion über das Sichtbare und das Wahr-Nehmen. Das Diktum „Ich sehe was ich sehe“ wird zu einer verstörenden und oft auch betörenden Erfahrung im Sehen des Sehens selbst. Nicht was man sieht wird relevant, sondern wie man etwas sieht.
Bei Jürgen Wagner geschieht dies nicht in Form eines intellektuellen, theoretischen Kunstdiskurses, sondern viel mehr als intuitives Ausloten unserer alltäglichen digitalen Bilderfahrungen mit den Mitteln der Malerei. Das Erleben von pikturaler Dysfunktionalität auf Grund von Defekten von Satellitenantennenanlagen war für ihn faszinierend und irritierend zugleich, so als ob er plötzlich Sehfehler im eigenen Sehen entdeckt hätte. Dass er seit längerem Seinsweisen unserer Medienrealitäten nachspürt und als Medienübersetzung formuliert, ist mehr als ein bildnerisches Anliegen – es ist zeitdiagnostische Empfindung einer sich digital totalisierenden Bilder-Gesellschaft.
© für den Text: Mag. Carl Aigner, Direktor des Landesmuseums NÖ
![]() Hartwig Knack
Hartwig Knack
Bildpunkte – Kodierung der Wirklichkeit
Jürgen Wagners pulsierende Malerei
Bilderwelten immer neu zu entwerfen und zu erfinden, Wirklichkeit auf vielfältige Weise zu interpretieren, ist seit jeher ein großer Anspruch der Kunst gewesen. Innerhalb der internationalen Diskussion um Bedeutung und Funktion bildender Kunst steht heute der mannigfaltige Begriff des Realismus wieder verstärkt im Blickpunkt der Debatte. Nach den sechziger und siebziger Jahren des Zwanzigsten Jahrhunderts ist in der letzten Dekade neuerlich eine deutliche Hinwendung zur figurativen Kunst festzustellen.
Finden Worte wie Realismus oder Wirklichkeit im Kontext künstlerischer Praxis Verwendung, so bekunden sie in der Regel die dezidierte Absicht des Kunstschaffenden, einen Ausschnitt aus der Realität unserer Umwelt – sei es auf einer Leinwand, einem Stück Papier, sei es in Form einer Skulptur, einer Rauminstallation oder Performance – der individuellen Wahrnehmung entsprechend wirklichkeitsgetreu wiederzugeben. Unvermittelt stellt sich die Frage nach der inhaltlichen Motivation, nach dem Warum.
Als Konstrukteur oder Gestalter von Realitäten formuliert auch Jürgen Wagner sein ganz persönliches Bild der Welt, oftmals, um sich selbst Klarheit über die Zeit, in der er lebt, über das Hier und Jetzt zu verschaffen. Wagner, 1964 in Wien geboren und in den Achtziger Jahren zum Gemälderestaurator ausgebildet, arbeitet als Maler prinzipiell in Serien: “pixit!“ und “Interferenzen“ und nennt er seine aktuellen Bilderfolgen, mit denen er facettenreiche Einblicke in flimmernde Welten gewährt.
Die Kunst, Pixel in Malerei zu verwandeln
Das Konzept eines Mosaiks ist seit tausenden Jahren hinlänglich bekannt: Durch Zusammenfügen verschiedenfarbiger Einzelteile entstehen Muster oder Bilder. Von weitem betrachtet verschmelzen die kleinen Teile respektive die Einzelbilder zu einem großen Gesamtbild.
Der Kybernetiker Leon D. Harmon arbeitete seit Mitte der Fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines der damals führenden Unternehmen der US-amerikanischen Telekommunikationsbranche. Insbesondere beschäftigte er sich wissenschaftlich mit Phänomenen der optischen Wahrnehmung. Als Wegbereiter der Digitalfotografie hat er Pionierarbeit geleistet und gilt als einer der ersten, der grafische oder fotografische Vorlagen in Bildpunkte = Pixel aufschlüsselte. Sein in Grauwerten “gepixeltes“ Porträt von Abraham Lincoln ist legendär. Salvador Dalí, Chuck Close und viele andere namhafte Kunstschaffende verwendeten in der Folge dieses "Mosaik-Prinzip" für ihre Kunst.
Jürgen Wagner steht mit seiner “pixit!- Serie“ in dieser Malerei-Tradition, nimmt auch bewusst die mit dieser Technik einhergehende Unschärfe in Kauf und stellt an den Blick der Betrachter vor allem die Herausforderung, zu abstrahieren und neu zu sehen, was unter der Klarheit unseres digitalen Zeitalters verloren gegangen ist. In seinen Gemälden konfrontiert uns der Langenloiser Maler mit dem Verhältnis von fotografischem Sehen und malerischer Konstruktion. So wird man vor jedem seiner Gemälde zu einem Spurensucher, der genüsslich in die Kodierung der gezeigten Welt eintaucht. Betrachtet man die Ölgemälde Wagners aus unmittelbarer Nähe, nimmt das Auge nichts als nebeneinander aufgereihte und farblich voneinander differenzierte Quadrate wahr. Aus einer gewissen Entfernung aber verschwimmt dieses Schachbrettmuster und konstituiert sich zu einem Portrait, einer Landschaft oder einer Architektur.
Was zunächst gewöhnlich erscheint, entpuppt sich beim Betrachten Wagners fertiger Werke als exakt ausgeführte Handarbeit. Was vorher die fotografische Abbildung einer Skulptur des italienischen Künstlers Alberto Burri oder die Impression eines Sonnenaufgangs waren, sind opalisierende Gemälde geworden, deren Form und Inhalt sich den Betrachtern nicht durchs erste Anschauen erschließen.
Die gewählte Rastergröße ist entscheidend für den Grad der Verzerrung. Unweigerlich ziehen die Bilder den Blick zuerst auf die malerischen Details, auf die mit hoher Genauigkeit geformten monochromen Quadrate, von denen farblich keines dem anderen zu gleichen scheint. Alle Karrees tragen den Duktus des Spachtels. Als sorgsam ausgefeiltes Raster verwischen die Quadrate einerseits zwar einen deutlichen Blick auf die ausgewählten Sujets, andererseits bringen sie das Dargestellte im gleichen Moment in neuer und oftmals überraschender Erscheinungsform zurück vor das Auge der Betrachter. Wir Rezipienten sind aufgefordert, visuell aktiv in das Bildgeschehen einzugreifen.
Überlagerung von Formen und Farben
Durch Jürgen Wagners Bereitschaft zur Abstraktion verzichtet er darauf, die gegenständliche Wirklichkeit nachzuahmen. Dennoch ist seine Art zu Malen keine Absage an den Gegenstand, hingegen eine Interpretation desselben. In der Werkreihe der “Interferenzen“ setzt sich der Künstler ebenfalls mit der digitalen Dekomposition von Bildern auseinander. Assoziationen zu Gesichtern und menschlichen Figuren, Landschaften, Straßenfluchten, Interieurs, Mobiliar und anderem mehr stellen sich teils sofort, teils beim näheren Hinschauen ein. Nicht verwunderlich, denn solche und ähnliche Motive sind Ausgangspunkte für diese Malereien. Mit Interferenz, einem aus der Physik entlehnten komplexen Phänomen, das insbesondere Überlagerungserscheinungen beim Zusammentreffen von Schall-, Licht-, und Materiewellen beschreibt, bezeichnet Wagner seine Bilder, deren motivische und räumliche Strukturierung sich mittels Durchdringung, Ergänzung, Überschneidung oder gegenseitiger Auslöschung von Farbfeldern entwickelt.
Das schwarze Balkenpaar am oberen und unteren Rand der Gemälde sticht sofort hervor. Als allseits bekanntes und charakteristisches Merkmal von im CinemaScope-Verfahren produzierten und via TV-Gerät gezeigten Kinofilmen ist zu vermuten, dass das Fernsehen Impulsgeber für das Entstehen dieser Leinwände war. In der Tat ließ sich Jürgen Wagner vor etwa einem Jahr durch Störungen des Satellitenempfangs, die Verzerrungen des Fernsehbildes hervorriefen, zu der bis dato etwa 20 Arbeiten umfassenden Serie inspirieren. Fasziniert beobachtete der Maler seinerzeit immer wieder, wie sich der Empfang auf seinem Fernsehschirm bei Regen oder Wind von Sekunde zu Sekunde verändert und sich das gestochen klare Bild zuweilen in abstrakte Formen auflöst um sich sogleich wieder in realistischer Darstellung aufzubauen.
Wagner überführt die verzerrten Fernsehbilder ins Medium der Malerei, belässt sie dabei als eine Art Chiffre, um unterschiedliche Ebenen der digitalen Welt zu akzentuieren und zum Vorschein zu bringen. Die farblich vibrierenden Ebenen der “Interferenzen“ lassen einen geordneten Blick in die Tiefe oder aus der Tiefe heraus einerseits nur schemenhaft zu, andererseits bilden sie überraschende Strukturen und eröffnen gänzlich neue Perspektiven. Durch Verschiebungen und systematische Überlagerungen kompositorischer Elemente entstehen vielfältige Bildräume, die eine Unterscheidung zwischen perspektivischer Nähe und Ferne für die Betrachter zu einer Fleißaufgabe machen. Neben dem Davor und Dahinter entsteht ein Dazwischen. Mittels horizontaler, vertikaler und diagonaler Linien einerseits, durch farbliche Verdichtung und transparente Offenheit andererseits verleiht der Künstler dem Diffusen in seiner Malerei dennoch eine gewisse Gliederung. Es bilden sich Bildebenen heraus, die partiell im Gegenständlichen verankert sind, zum Teil aber ein hohes Abstraktionspotential für sich beanspruchen.
Seine Malereien sind jedoch weit mehr als bloße Farb- und Formgefüge. Ihnen immanent ist eine deutliche kommunikative Struktur. Wagner setzt die einzelnen Bildpartien in Beziehungen, die eine spannungsreiche Auseinandersetzung durch die Zuweisung der Elemente sowohl auf der Fläche als auch in der Tiefe bewirken. Dabei entstehen zum einen kompositorische Verdichtungen, denen man Figuratives zuweisen kann. Zum anderen gibt es etwa Vorder- und Hintergründe und lineare Verläufe, die diese gedanklichen Verknüpfungen wieder auflösen, brechen oder ihnen eine neue Struktur entgegensetzen. So faszinierend und nebulös sich für Jürgen Wagner das physikalische Phänomen der Interferenz bildnerisch darstellt, so vielschichtig und fragmentarisch zugleich öffnen sich uns seine Bildwerke.
Abstraktion und Figuration
Das letzte Jahrhundert gilt als das Jahrhundert der Bilder. Die tägliche Flut von Bildern, die bewusst oder unbewusst auf unterschiedliche Weise wahrgenommen wird, prägt Vorstellungen von Realität. So entstehen unablässig – zum Teil sich widersprechende – Ideen und Definitionen von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Entscheidend für eine qualitätsvolle Weiterentwicklung österreichischer Kunst ist, dass Künstlerinnen und Künstler wie Jürgen Wagner auch im 21. Jahrhundert versuchen, allgemeine und auch ganz persönliche Erfahrungen der Gegenwart in ihrer künstlerischen Produktion zu reflektieren, ihr eigenes Bewusstsein quasi “mit ins Bild“ bringen und Realität als gesellschaftlich veränderbar erkennen.
Mit dem handwerklichen Know-how des Gemälderestaurators einerseits und der maltechnischen Akribie des Künstlers andererseits drängt Jürgen Wagner sein Publikum zu einer Abstraktionsarbeit, zu der es im Alltag nur selten aufgefordert wird. Durch den Zwang unserer Wahrnehmung, auf seinen Bildern einen noch so kleinen Hinweis zu finden, der Aufschluss über das Dargestellte gibt, wirft Wagner Fragen nach unserer immer stärker medial strukturieren Kultur auf. Seine Kunst setzt sich inhaltlich einerseits mit Medienkonsum und dem Wahrheitsgehalt von Bildmedien auseinander, andererseits reflektieren die Motive auf formaler Ebene Sinneseindrücke und alltägliche Dinge der Umwelt. Jürgen Wagners Verständnis von Kunst stützt sich grundsätzlich auf ein Spiel von Formen und Farben, von Überlagerung und Durchbrechung, Oberfläche und Raum, Vollständigkeit und Auflösung. Die Konfrontation aus Abstraktion und ihrer Verwurzelung in einer meist banalen Realität macht die Spannung seiner exzeptionellen malerischen Position aus, mit der er die uns umgebende Wirklichkeit um eine neue Facette erweitert.
© für den Text: Mag. Hartwig Knack, Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler




